
Morgens halb zehn in Deutschland – die Brotdosen sind noch nicht ganz geschlossen, das Postfach schon halb überfüllt – und auf dem Tisch dampft der Kaffee. Wer denkt in diesem Moment daran, dass dieses selbstverständliche Getränk vor Jahrhunderten einmal in den Gassen Mekkas sprachlich in die Fußstapfen des Weines trat?
Die ersten Bohnen
Die Wurzeln des Kaffees liegen allerdings tief im Hochland Äthiopiens. Dort, so sagt die Legende, soll ein Hirte im 9. Jahrhundert beobachtet haben, wie seine Ziegen nach dem Verzehr roter Kirschen ungewöhnlich munter wurden.
Zwischen der Handlung dieser Legende und der Entdeckung des Kaffees als Getränk sollen dann mehrere Jahrhunderte liegen.
In Äthiopien und im südlichen Arabien wurden die Kirschen zunächst zwar genutzt, aber anders: man kaute sie roh, mischte sie mit Fett zu einer Art Energieball oder kochte die Schalen als aufmunternden Aufguss. ‘Kaffee’ war in dieser Zeit mehr Heilmittel und Wegzehrung als gesellschaftliches Getränk. Erst im 15. Jahrhundert fanden Sufi-Orden im Jemen heraus, dass die gerösteten und aufgebrühten Bohnen ihnen halfen, die Nacht wach und konzentriert im Gebet zu verbringen.
Von Mekka nach Bremen
In den Städten Aden und Mokha entwickelte sich danach schnell eine eigene Kaffeekultur. Mokha, jener Hafen, dessen Name bis heute als Synonym für aromatischen Kaffee steht, wurde zum ersten großen Umschlagplatz. Händler brachten den Kaffee von hier aus ins jemenitische Hochland, wo Gelehrte und Mystiker ihn in ihre religiösen Zusammenkünfte integrierten.
Von den großen Zentren des Jemen – Sana’a, Zabid, Ta’izz – führte der Weg schließlich weiter nach Mekka. Dieses war als Pilgerzentrum ein idealer Ort für Gebet und Socializing: Muslime aus Persien, Indien, Nordafrika und Anatolien trafen hier zusammen. Und viele nahmen den Kaffee mit nach Hause, sodass das Gebräu in kürzester Zeit den gesamten islamischen Raum erreichte.
Über Kairo und Damaskus kam der Kaffee auch nach Istanbul, wo er im 16. Jahrhundert fester Bestandteil des Hoflebens wurde. Europa erreichte er über zwei Seewege: über das Mittelmeer nach Venedig und Marseille – und über die norddeutschen Hansestädte. 1673 eröffnete in Bremen das erste Kaffeehaus Deutschlands. Bald folgte Hamburg, wo Schiffe vollbeladen mit Kolonialwaren anlegten. In Leipzig spielte man bereits 1734 eine „Kaffeekantate“. Man kann sich fragen: Was hätte Bach komponiert, wenn der Kaffee nicht gekommen wäre – vielleicht eine „Bierkantate“ – und wie hätte die dann geklungen?
Parallel dazu entstand die Wiener Kaffeehauskultur. Ob die Geschichte mit den zurückgelassenen Säcken Kaffees nach der Türkenbelagerung von 1683 stimmt oder nicht – sicher ist, dass Wien einen eigenen Typus des Kaffeehauses schuf: halb Wohnzimmer, halb Salon, ein Ort für Politiker, Literaten, Künstler. Diese Mischung wirkte stilprägend bis nach Deutschland und in die Schweiz. Wer heute von der „Kaffeekultur“ spricht, denkt unwillkürlich auch an Wien.
Die Sprache erzählt mit
Das Wort Kaffee selbst verrät seine bemerkenswerte Herkunft: aus dem Arabischen »qahwa« wurde im Türkischen »kahve« und im Deutschen schließlich »Kaffee«. In frühen arabischen Texten bezeichnete »qahwa« allgemein ein Getränk, das den Appetit zügelte. Damit war auch der Wein gemeint, dessen appetitanregende Wirkung sich in größeren Mengen bekanntlich umkehrt. Später übertrug man den Begriff auf das neue Getränk, das jedoch nicht berauschte, sondern vielmehr Wachheit verlieh.
Ob nun die Melange in Wien, Filterkaffee in Hamburg oder ein Espresso in Berlin – was für uns in Europa Alltag ist, war einmal ein netter Begleiter in religiösen Kreisen und kulturelle Revolution zugleich. Und jedes Mal, wenn wir »Kaffee« bestellen, greifen wir unbewusst nach einer Geschichte, die ihren Duft und Geschmack im muslimischen Kulturraum fand.
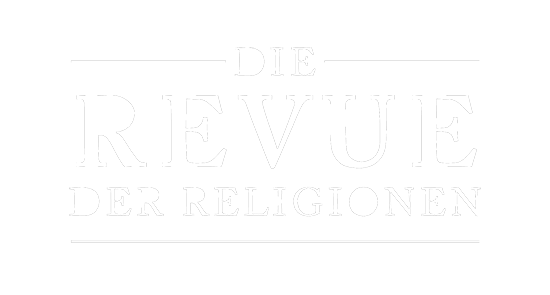

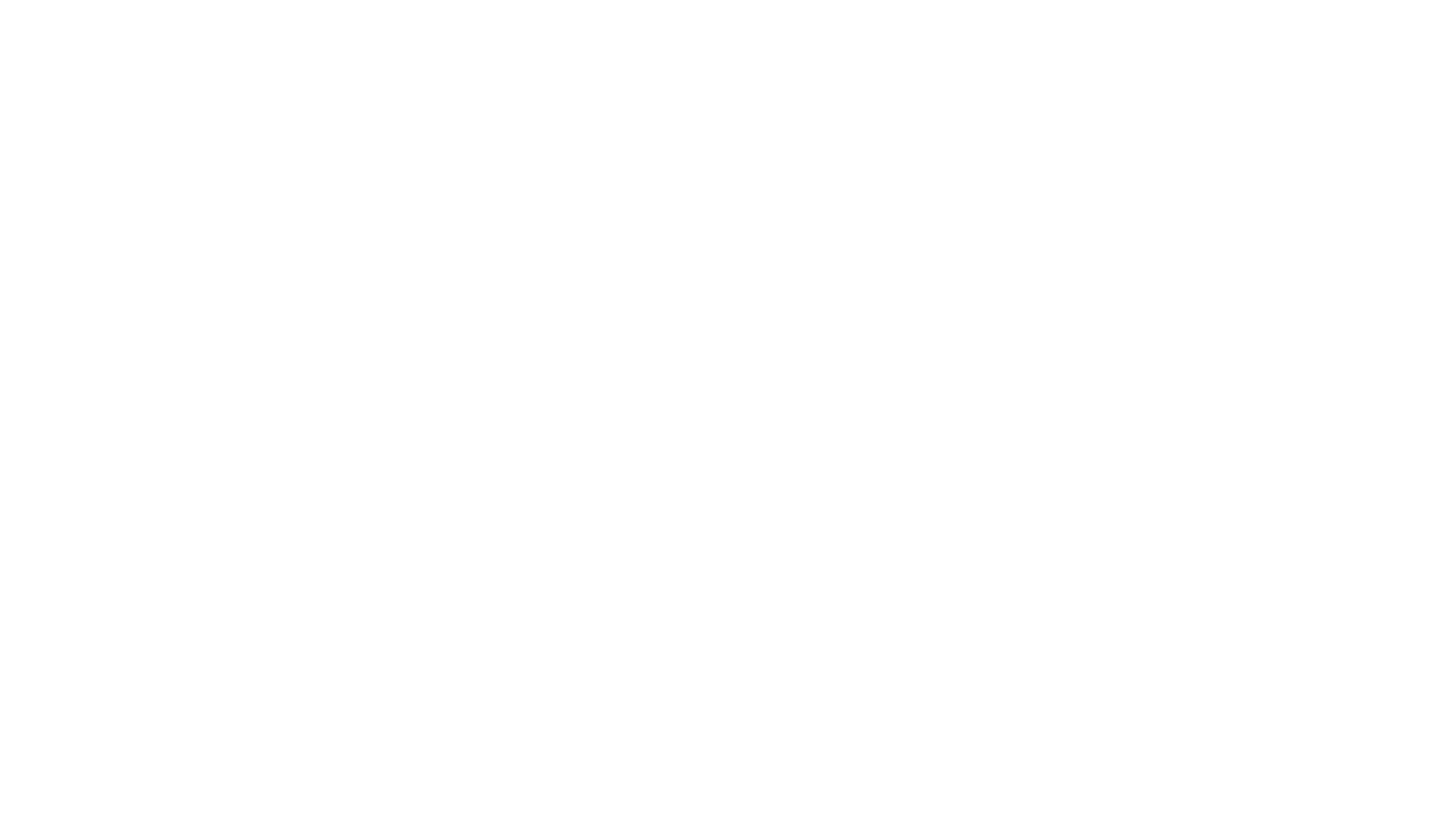
Kommentar hinzufügen