
von Yunus Mairhofer
Arroganz und systemische Krise
Ereignisse überschlagen sich. In den Trümmern Gazas und den Steppen Sudans herrscht weiter Krieg und Vertreibung. Die Großmächte – wenn nicht direkt selbst involviert – liefern Waffen an mehrere Fronten. Russland und China bauen ihre Allianz aus, während die Vereinigten Staaten versuchen, ihre zerfallende Ordnung aufrechtzuerhalten.
Europa wirkt indes müde, Deutschland ringt mit sich selbst, Frankreich schwankt zwischen innerem Verfall und äußerer Härte. An diesem Schauplatz der Unsicherheit erschallen (leere) Forderungen nach Deeskalation einerseits – und Appelle zur notwendigen Aufrüstung auf der andren – als lähmender Missklang, ja Störgeräusch.
Der Qur’an, das heilige Buch der Muslime, warnt und spricht in mehreren seiner Verse von Nationen, die in Hochmut lebten. Von solchen, die sich für unbesiegbar hielten (vgl. 41:16), weil sie Macht hatten, Handelswege kontrollierten, Mauern bauten und Bündnisse schlossen. Sowohl das Volk der ʿĀd, dessen technologische Fähigkeiten beeindruckten, als auch das Volk von Saba, das über ein komplexes Wassersystem verfügte, beide gingen sie unter – nicht wegen mangelnder Technologie, sondern wegen mangelnder Demut. Arroganz war nicht nur eine Verfehlung, sie war System.
Tatsächlich lässt sich auch die globalisierte Selbstüberhöhung heute systemisch verstehen. Eine westliche Ordnung, die behauptet, universelle Werte zu verkörpern – und doch bei jeder Gelegenheit mit zweierlei Maß misst. Sie fordert Demokratie, wo es ihr passt, und ignoriert sie, wo es sie stört. Sie beruft sich auf die Menschenwürde – und nimmt Tausende von Kindern, die in Gaza getötet wurden und werden, als Kollateralschaden hin.
Doch weder das Christliche Abendland noch die sogenannte Islamische Welt sind aufgrund ihres religiösen Erbes in Konflikten festgefahren. Viel eher scheinen die einen wie die anderen der Idee der Kontrolle verfallen zu sein. In dem Glauben, dass alles – Klima, Krieg, Kultur, Menschen – mit genügend Macht, Geld oder Technologie kontrolliert werden kann. Diese Anschauung ist wiederum ›religiöser‹, als ihre treuen Anhänger zugeben würden. Aber es ist in Wahrheit eine Ersatzreligion. Sie ersetzt Demut vor dem Schöpfer durch die trügerische Selbstermächtigung des Menschen.
Symptomatischer Vertrauensverfall
Politische Institutionen verlieren indes weltweit das Vertrauen ihrer Bürger. Laut dem Edelman Trust Barometer 2024 gaben im globalen Durchschnitt nur 51 % der Befragten an, ihrer Regierung zu vertrauen – ein Wert, der lediglich im sogenannten ›Neutralbereich‹ liegt.
Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits seit Jahren beobachtet wird: 2019 lag das Vertrauen in Regierungen global noch bei 56 % – seither ist es kontinuierlich gesunken. Dieser ›Neutralbereich‹ (50–59 %) bedeutet auch nicht, dass eine stabile Vertrauensbasis besteht – sondern im Gegenteil: Er zeigt eine fragile Balance, bei der fast die Hälfte der Bevölkerung der Regierung eher misstraut oder ihr zumindest keine klare Legitimität zuspricht.
In Deutschland fiel derselbe Wert innerhalb weniger Jahre sogar um über 10 Prozentpunkte auf nur 42 %.¹ Das signalisiert nicht bloß momentane Unzufriedenheit, sondern eine strukturelle Vertrauenskrise.
Was fehlt, ist hier nicht nur die oft propagierte Transparenz, sondern ein ethisches Fundament. Entscheidungen erscheinen immer offensichtlicher als interessengeleitet, kurzfristig oder technokratisch. Es ist ganz klar die moralische Glaubwürdigkeit der politischen Akteure mit der das Vertrauen der Bürger schwindet.
Religion als politische Ressource – keine Herrschaft, sondern Orientierung
Eine wahre Religion, die sich nicht missbrauchen lässt, erinnert hier den Einzelnen wie ganze Gesellschaften daran, dass Macht nicht Selbstzweck ist, sondern Verantwortung bedeutet. Sie lehrt Maß, Demut und Weisheit – Tugenden, die im politischen Betrieb kaum mehr eingefordert werden, obwohl sie für Führung essenziell sind.
Die Religion des Islam fordert – entgegen vieler Behauptungen – keine Herrschaft im weltlichen Sinn. Sie unterscheidet klar zwischen geistlichem Anspruch und politischer Macht. Ziel ist nicht die Errichtung eines Gottesstaates, sondern die Prägung politischer Kultur durch ethische Maßstäbe. Religion wirkt nicht durch Zwang, sondern durch Haltung – sie fordert Ehrlichkeit, Integrität, Sinn für Gemeinwohl und faire Regeln im weltweiten Austausch und Handel.
Die Anerkennung dieser Werte wird sich nicht nur auf Gläubige beschränken. Auch die allermeisten Menschen, die sich nicht als religiös verstehen, können erkennen, dass ohne moralische Verankerung weder Wettbewerb gerecht noch eine Gesellschaft stabil bleibt. In einem Klima wachsender Verdrossenheit kann genau dies verlorenes Vertrauen zurückbringen: wenn Verantwortung wieder wichtiger wird als Taktik.
Der Qur’an nimmt dafür gleichzeitig das Volk als auch seine Vertreter in folgendem Vers in die Verantwortung:
„Allah gebietet euch, die Treuhandschaft denen zu übergeben, die ihrer würdig sind.“ (4:59)
Das ist nicht bloß ein geistiger Appell, sondern ein politisches Prinzip und das Fundament für die Trennung von Religion und Staat. Es verlangt, dass Macht auf Charakter fußt – nicht auf Religionszugehörigkeit oder Parteibuch noch auf Lautstärke oder Strategie.
Solange die Politik nicht zu dieser Umkehr fähig ist, verliert sie weiter ihre Integrität und eine Gesellschaft, die keine Hoffnung auf Gerechtigkeit mehr hat, verliert ihre Richtung. Wo Gott aus der Ordnung verschwindet, verschwinden zwangsläufig auch die mit Ihm verbundenen Werte wie objektives Maß und Verantwortlichkeit. Dann lautet die Frage nicht mehr: „Sollten wir das tun?“, sondern einfach: „Lohnt es sich?“
Gottlose Sprache?
Während mit einfallenden Armeen auch diese Form des Atheismus täglich Landgewinne verzeichnet, ist es kein Zufall, dass auch religiös geprägte Sprache verstummt. Religiöse Begriffe wie Gottvertrauen, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit werden von vielen als archaisch angesehen. Wobei gerade diese Konzepte, die in jeder Religion vorhanden sind, der Welt die dringend nötige Korrektur bieten können.
Gottvertrauen bedeutet beispielsweise nicht Passivität, sondern das Eingeständnis: Der Mensch hat nicht alles unter Kontrolle – und schützt so vor Überheblichkeit. Bei absoluter Gerechtigkeit (islam. Àdl) geht es nicht nur um faire Verteilung, sondern auch um ein Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten. Wer nur Rechte einfordert, ohne Verantwortung zu übernehmen, spaltet die Gesellschaft, anstatt Ausgleich zu schaffen. Das aus der Religion stammende Konzept der Rechtschaffenheit wiederum bedeutet auch Selbstbeschränkung – nicht aus Angst, sondern aus Einsicht in die eigene Abhängig- und Bedürftigkeit.
Was, wenn diese Begriffe nicht nur fromme Verzierungen sind, sondern tatsächlich auch Grundpfeiler gesellschaftspolitischer Kultur?
Die Welt taumelt, weil sie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Eine religiöse Sichtweise ist dabei kein privates oder alternatives Programm, sondern eine Erinnerung an alle: Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Er ist verantwortlich. Und er ist rechenschaftspflichtig – nicht nur vor der Geschichte, sondern vor seinem Schöpfer. Diese Perspektive ist heute ebenso unpopulär wie unbequem. Aber sie ist heilsam. Denn vielleicht beginnt Frieden nicht auf Gipfeln und Konferenzen, sondern zuallererst in Herzen, die sich selbst hinterfragen.
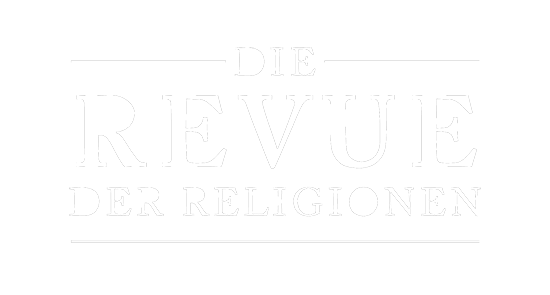




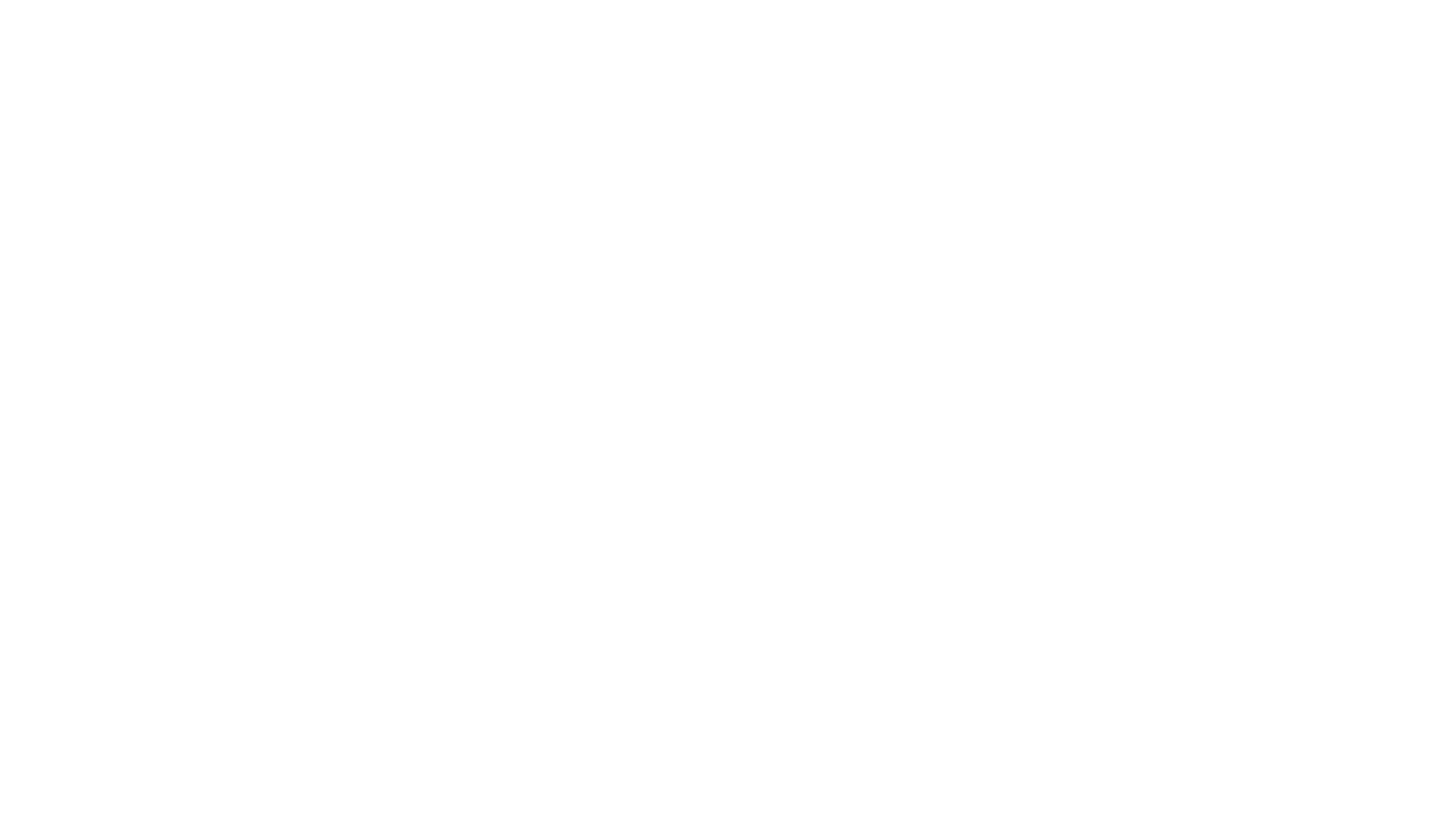
Kommentar hinzufügen