
von Yunus Mairhofer
Letztens kam ein Bekannter vorbei, der seit längerem einen schweren inneren Kampf bestreitet. Er leidet unter anderem an extremen Stimmungsschwankungen – vom Hochgefühl in den Keller. Bemerkenswerterweise spiegelt auch sein Kleidungsstil genau das wider: immer alles weiß oder alles schwarz. Ihm seien die folgenden Eindrücke gewidmet.
Im Heiligen Koran gibt es Verse, die weniger erklärt als erfahren werden wollen. Ein solcher steht scheinbar unauffällig inmitten einer Passage über das Volk der Schrift – und reicht doch in eine Tiefe, die weit über diesen Kontext hinausreicht. Es ist die Aussage:
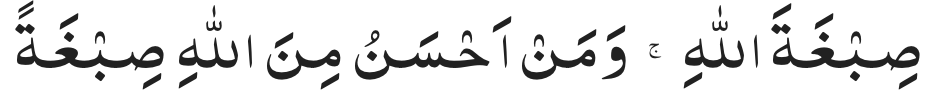
»Die Farbe Allahs! – und wer färbt schöner ein als Allah?«
(Koran, Sure 2, Vers 139)
Die arabische Wurzel ṣ-b-gh des Wortes ›Sibgha‹ – das hier vereinfacht als Farbe übersetzt wird – bedeutet ursprünglich »färben, tränken, durchdringen«, bis hin zu »taufen«. Was hier als »Farbe Gottes« auftaucht, meint also nicht bloß einen äußeren Anstrich. Es geht um eine völlige Durchfärbung, eine Prägung und Umwandlung – so, wie ein Stück Stoff durch das Bad in kräftiger Farbe dauerhaft seine Erscheinung und Natur verändert. Wer sich wirklich auf Gott einlässt, wird nicht nur getüncht, sondern durchdrungen. Und obwohl man sich dabei aufgibt, verliert man keineswegs sich selbst – viel eher findet man zu jenen tiefen Farben des eigenen Wesens, die in jedem Menschen durch Gottes Hand bereits angelegt sind. Doch eins nach dem anderen.
Wie wird ›Farbe Gottes‹ gedeutet?
Die klassischen Kommentatoren des Heiligen Koran haben den Ausdruck ṣibghatallāh (Farben Gottes) unterschiedlich gedeutet. In der Grundrichtung einigt sich die islamische Überlieferung darauf, dass es sich mit dem Ausdruck um die Prägung durch die Religion handelt – durch Gottes Wegweisung, durch das Verstehen Seiner Eigenschaften und das Befolgen Seiner Gebote. Der Gelehrte at-Tabarī etwa erklärt die »Farbe Gottes« als die Religion Gottes, d. h. den reinen Islam, im Kontrast zu den Riten und Formeln anderer Religionen, die oft schon kurze Zeit nach ihrer Entstehung eingeführt wurden. Der Exeget az- Zamachscharī deutet ṣibghatallāh als eine Metapher für göttliche Wahrheit.
Der Zweite Kalif der weltweiten Ahmadiyya-Bewegung, Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra), schreibt in seiner Großen Exegese:
»Gott weist in diesem Vers darauf hin: In dieser Welt könnt ihr ohnehin nicht verharren, ohne die Farbe von irgendjemanden angenommen zu haben. Wenn ihr also ohnehin irgendeine Farbe annehmt, so raten Wir euch an: Übernehmt nicht die Farbe eurer Freunde. Übernehmt nicht die Farbe eurer Ehefrauen und Kinder. Übernehmt nicht die Farbe eurer Lehrer. Übernehmt nicht die Farbe eures Umfelds. Übernehmt nicht die Farbe eurer Regierung – sondern nehmt die Farbe des Einen Gottes an. Denn Er hat euch erschaffen, und nur die Verbindung zu Ihm kann euch Erlösung bringen. Wa man ahsanu mina-llāhi ṣibgha: ›Und wer könnte euch besser und schöner färben als Allah?‹ – Nach dieser Färbung werdet ihr nicht zu einem verkleideten Schauspieler, sondern zu einem der schönsten Wesen, dessen Anblick die Augen der Welt in helles Staunen versetzt. Zudem wird Gott euch mit Seinen Zwiegesprächen und Anreden ehren, und euch mit außergewöhnlichen Belohnungen erfüllen.«[1]
Bemerkenswert, wie der Koran im Ausdruck dieser Verse fast schon herausfordernd klingt: »Und wer färbt schöner als Allah?« Wie unsere Lebenserfahrung bestätigt, färbt sich jeder Mensch im Leben zwangsläufig – durch Familie, Freunde, Gesellschaft, Medien, Gewohnheiten, Leidenschaften. Doch keine dieser Farben ist von Dauer und das Schmücken mit fremden Federn lässt das Herz ewig unruhig und unzufrieden zurück. Allein wer die göttliche Färbung annimmt, ist wirklich und dauerhaft geschmückt. Alles andere sind nicht wir selbst, sondern ist reine Maskerade.
Die Farbe Gottes – eine Verwandlung des Inneren
Viele Exegeten sind sich weiters auch einig, dass es sich bei der Metapher ›Farben‹ tatsächlich um Gottes Eigenschaften handelt.
»So wie Gott der Bedecker von Fehlern ist, kann auch der Mensch Bedecker sein. So wie Gott der Erkenntliche ist, kann auch der Mensch dankbar sein. So wie Gott der Schenkende ist, kann auch der Mensch schenken. So wie Gott der Allversorger ist, kann auch der Mensch jene in seinem Kreise versorgen. In Wahrheit kann allein derjenige die Nähe Allahs erreichen, wer zum Spiegel göttlicher Eigenschaften wird, dadurch Annahme in Allah findet und so mit Seiner Farbe gefärbt wird.«[2] (Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra))
Der Koran nennt viele weitere dieser Merkmale Gottes – bekannt unter den ›99 Namen‹. Wer sich Allah vollständig anvertraut, wird barmherzig wie Er, gerecht gegenüber anderen als auch gegen sich selbst, geduldig in der Prüfung, dankbar im Überfluss, ehrenhaft selbst im Verlust. Diese sogenannten – aus den Köpfen vieler Menschen scheinbar verschwundenen – Tugenden sind keine individuellen Erfolge. Es sind Spuren, Pinselstriche des Schöpfers im Geschöpf.
Die göttliche Farbe wirkt also wie ein leiser, aber stetiger Prozess – nicht in plötzlicher Euphorie oder Ekstase. Sie zeigt sich nach und nach in Worten oder Gesten, vor allem aber in der Wandlung der innersten Prioritäten. Was vorher wichtig war – Ansehen, Besitz, Einfluss – verliert an Gewicht. Was vorher nebensächlich schien – Gottes Nähe, Aufrichtigkeit, Dienst an der Menschheit – wird zur Quelle aller Freude. Diese Verlagerung des inneren Zentrums ist das sicherste Zeichen dafür, dass der Mensch vom Lichtspektrum Gottes berührt ist.
Die Welt, in der wir unser Leben bestreiten, ist ein Ort der ständigen Einfärbung. Sie wirbt mit ihren eigenen Tönen: der glänzenden Farbe des Erfolgs, dem künstlichen Licht der Aufmerksamkeit, dem trügerischen Schein der Selbstverwirklichung. Wer jedoch immer wieder in Gottes Farben eintaucht, bleibt vor falschem Glitzer bewahrt sowie davor, die Dinge in schwarz und weiß zu sehen.
__________________
Über den Autor: Yunus Mairhofer ist ausgebildeter Ethnologe, Trainer für Deutsch als Fremdsprache und Teil des Redaktionsteams der Revue der Religionen.
Referenzen:
[1] Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra): Tafsir-e-Kabir. Band 2, S. 515 f.
[2] ebd., S. 515.
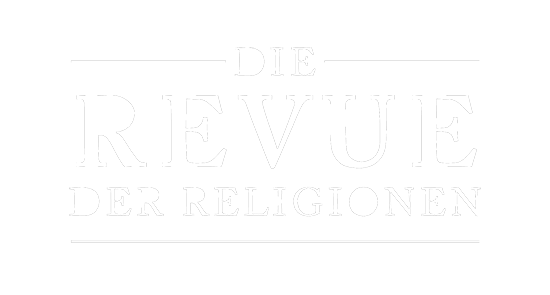

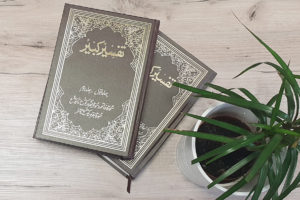


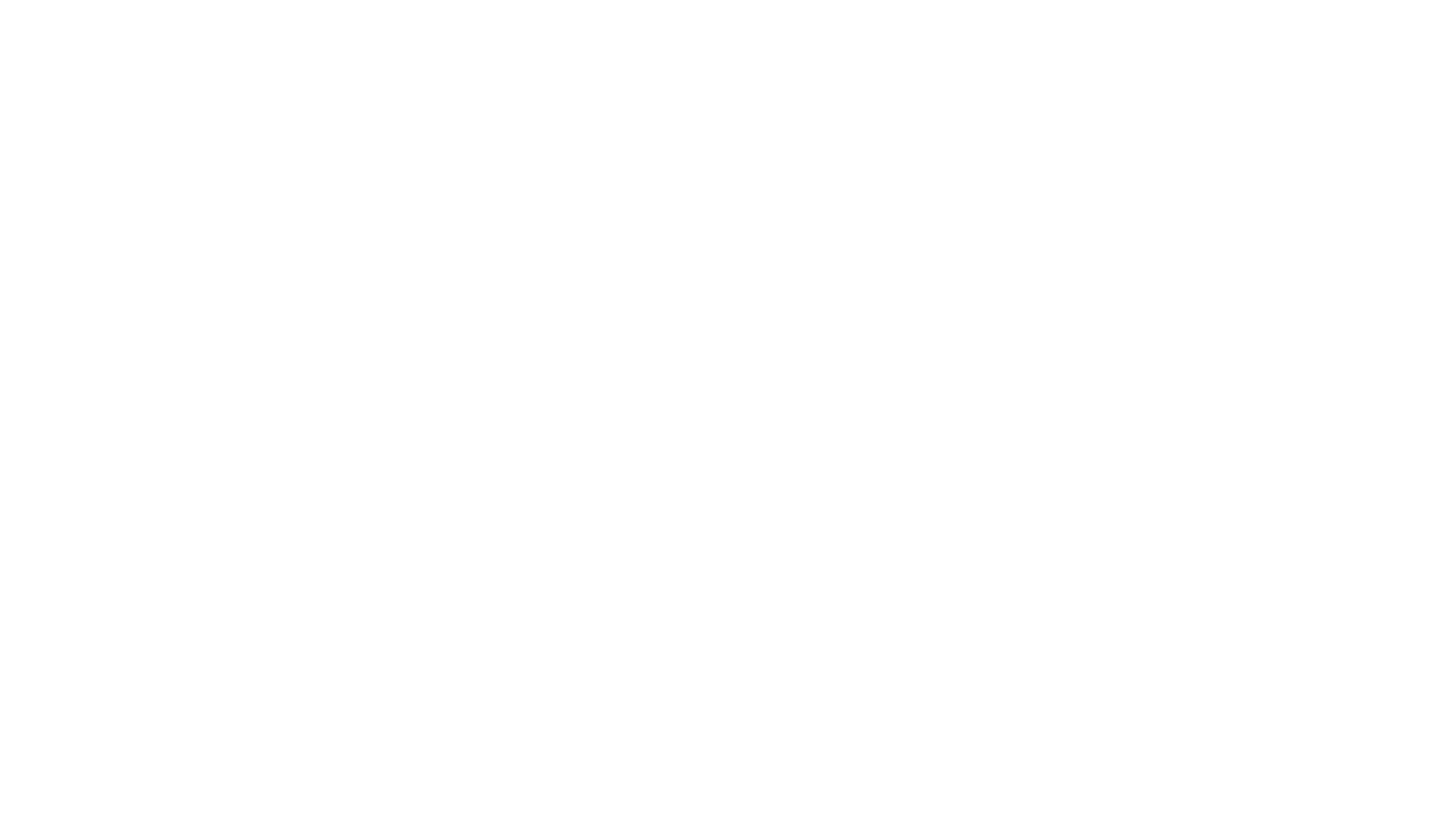
Kommentar hinzufügen