von Khola Maryam Hübsch
Hass ist eine notwendige Vorbedingung für den Krieg, nicht aber seine Ursache, schrieb Erich Fromm. Doch was geschieht, wenn wir vor allem über den Hass sprechen? Und dabei die Ursachen aus den Augen verlieren? Bekämpfen wir damit den Hass? Oder tragen wir dazu bei, dass dieser weiter gedeihen kann?
So als habe es die rassismuskritische Aufklärungsarbeit der letzten Jahre nicht gegeben, wird derzeit wieder über »importierten Antisemitismus«, »Aggro-Araber« und Leitkultur diskutiert. Der Hass scheint eine Spezialität der anderen zu sein, der Araber, der Muslime.
Zwar beteuern deutsche Politiker fortwährend, man dürfe Muslime nicht unter Generalverdacht stellen, allerdings nur, um gleichzeitig eine Distanzierung vom Terror zu fordern, die genau diesen Generalverdacht voraussetzt. So werden Muslime en passant zu potenziellen Terror-Unterstützern erklärt. Gefühlt ist das ein Backlash in die 9/11-Ära, zurück in den Krieg der »westlichen Welt« gegen die »muslimischen Terroristen«. Deutschland sei als nächstes dran, warnte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erst kürzlich.
Muslime sind selbst schuld
Was bleibt, ist der fade Geschmack des alten »wir gegen die«-Denkens. Es ist das immergleiche Diskursmuster, das sich auf unterschiedlichen Ebenen Bahn bricht. Betrachten wir die integrationspolitischen Debatten der letzten Jahre, wird deutlich, dass es eine drei-stufige Blaupause gibt, die auch in der aktuellen Verhandlung des Nahost-Konflikts zum Tragen kommt.
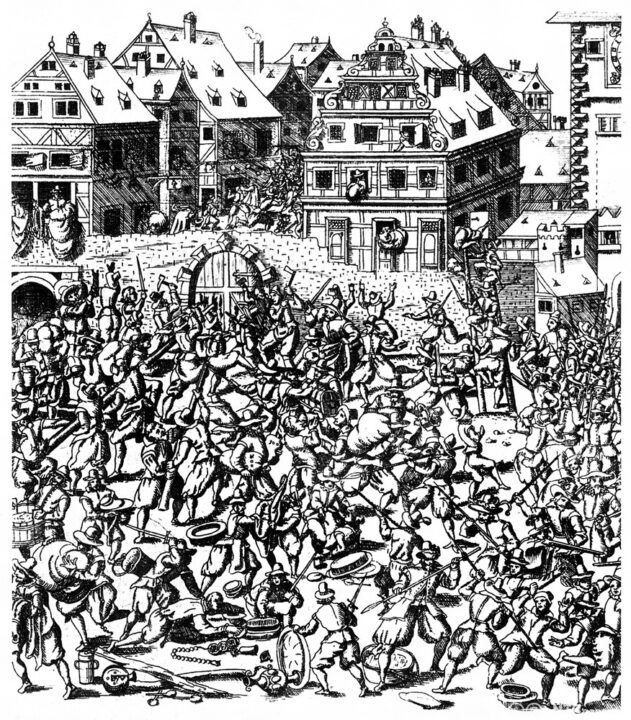
Unabhängig davon, um welches migrationspolitische Thema es geht – sei es Antisemitismus, Sexismus oder Jugendgewalt – werden im ersten Schritt der öffentlichen Debatte Missstände entpolitisiert, indem sie »muslimifiziert« werden. Der Bestsellerautor Thilo Sarrazin war mit dieser Methode besonders erfolgreich.
Statt zu analysieren, welche Umstände ein Problem hervorrufen und über Sozialisierungseffekte, soziale Ungleichheit, Bildungsmangel, fehlende Chancengleichheit oder Armut zu sprechen, wird behauptet, es liege an den »Werten« der Muslime, die Religion sei die Hauptursache für Fehlentwicklungen.
Das ist eine bequeme Erklärung, denn sie hat eine psychologische und politische Entlastungsfunktion. Die Politik muss sich nicht verantworten für ihr wirtschafts-, integrations- und bildungspolitisches Versagen und die Mehrheitsgesellschaft kann marginalisierten Gruppen ohne schlechtes Gewissen ihre Empathie verweigern, denn diese sind ja offensichtlich selbst schuld, wenn sie eine derart rückständige Religion haben.
Mythen aus der islamfeindlichen Mottenkiste
Folgerichtig kommt es im zweiten Schritt zu einer Entsolidarisierung mit den Betroffenen. Sie werden weniger als Menschen mit Sorgen und Nöten wahrgenommen, denn als Sicherheitsrisiko. Jeder zweite Deutsche sieht laut Erkenntnissen des Expertenkreises Muslimfeindlichkeit den Islam als Bedrohung und stimmt muslimfeindlichen Äußerungen zu.
Die Konsequenz ist, dass im dritten Schritt Verbote, Restriktionen und Sanktionen gegen Muslime gefordert werden – auch wenn sie verfassungswidrig sein sollten.
Nach dem menschenverachtenden Angriff am 7. Oktober 23 ist die deutsche Debatte in genau dieses Muster zurückgefallen. Vom Vize-Kanzler Robert Habeck bis zum Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und der Innenministern Nancy Faeser forderten allesamt ein klares Bekenntnis der Muslime gegen Antisemitismus – als sei Antisemitismus ein Spezifikum der Muslime. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff behauptete auf der Deutschen Islamkonferenz gar, die Wurzeln des Judenhasses lägen in der Geschichte des Islam. Allerlei Mythen aus der islamfeindlichen Mottenkiste sollen diese These belegen.
Bemüht werden Qur’an-Verse, die Juden kritisieren. Und auch die Behauptung, der Prophet (saw) habe einen jüdischen Stamm ermorden lassen, kursiert wieder in deutschen Feuilletons. Nicht erwähnt wird, dass der Qur’an den Juden (sowie Christen und Muslimen) das Paradies verspricht und nur diejenigen Juden (sowie Christen und Muslime) tadelt, die sich von Gott abgewandt haben. Nicht erwähnt wird, dass der Qur’an zum Schutz von Synagogen (und Kirchen und Moscheen) aufruft. Oder dass der Prophet Muhammad (saw) einen bemerkenswerten Friedensvertrag mit jüdischen Stämmen in Medina schloss. Erst der Bruch dieses Vertrags durch einen jüdischen Stamm führte zu einem Zwei-Fronten-Krieg der Muslime. Es war dieser Hochverrat, für den der besagte, jüdische Stamm nach dem mosaischen Gesetz gerichtet werden sollte, das nun mal die Todesstrafe vorsieht – die allerdings nicht durch den Propheten verhängt wurde, sondern durch einen von ihnen selbst ausgewählten Schiedsrichter.
Wer diesen Kontext vorenthält, beteiligt sich an der Verbreitung des Narrativs, das der Islam in den Juden den Erzfeind ausmachen würde und zementiert damit letztlich antisemitisches Gedankengut.
Dabei gibt es eine große Wertschätzung für jüdische Propheten im Heiligen Qur’an, die von der Kritik am Verhalten einer spezifischen Gruppe von Juden in einer Kriegssituation zu unterscheiden ist. Derzeit sind derartige Differenzierungen aber nicht wirklich beliebt. Lieber hält man fest an der These eines islamisch legitimierten Judenhasses.
Kommt als nächstes das Wassermelonenverbot?
Gilt die Kultur der Muslime erst einmal als Ursache für den steigenden Antisemitismus in Deutschland, ist der Ruf nach Restriktionen und Verboten nicht weit. »Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land«, erklärt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Die Lösungsvorschläge zur Bekämpfung des »muslimischen Antisemitismus« sind vorhersehbar: leichtere Abschiebungen, Demonstrationsverbote, Palästinenserflaggenverbot, Kufiyatrageverbot.
Ausgerechnet die frühere Bundesjustizministerin und heutige NRW-Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger schlug gar vor, das Recht auf Versammlungsfreiheit für Ausländer einzuschränken. Die Grundrechte für Minderheiten derart zu begrenzen, wäre eindeutig verfassungswidrig, der Vorschlag wurde zurückgenommen. Angesichts der Absurdität der Verbotsforderungen, hätte nur noch gefehlt, ein »Wassermelonen-Verbot« zu verlangen, schließlich gilt die Frucht als Zeichen für palästinensischen Widerstand.
Antisemitische Äußerungen können bei geltender Rechtslage bereits geahndet werden. Die Verbotsforderungen wurden von vielen Muslimen daher als Versuch gewertet, jeden Ausdruck der Solidarität mit palästinensischen Opfern als antisemitisch zu kriminalisieren.
Das hat indes nicht viel mehr bewirkt, als eine bereits wahrgenommene Benachteiligung unter muslimischen Deutschen zu verstärken. Dabei sind Unrechtserfahrungen ein wichtiger Katalysator für die Entstehung von Frustration und letztlich Hass.
Nicht nur viele Deutsch-Palästinenser erinnern sich gut daran, wie demütigend die »Kettenduldungen« waren, die sie jahrelang zum Nichtstun verurteilten, wie ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden, wie sie auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt diskriminiert wurden – und werden. Diese vielen Mikroaggressionen gehören für Muslime zum Alltag in Deutschland – wenn sie beten oder fasten, wenn sie Kopftuch tragen oder sich anderweitig zu ihrer Religion bekennen, ebenso wie Racial Profiling und herablassende Blicke und Sprüche. Es sind genau diese Abwertungen, deretwegen sie sich mit ihren Glaubensgeschwistern in Nahost identifizieren können.
Ohne soziale Gerechtigkeit kein Frieden
Die strukturelle Ungleichbehandlung, die die Palästinenser indes im Westjordanland erleben, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, demütigende Kontrollen an Checkpoints, die Aufhebung grundlegender Bürgerrechte für Millionen bis hin zu Zwangsumsiedlungen und Enteignung und der Blockade des Gazastreifens – es ist dieses Unrecht, das deutsche Muslime an ihr Underdog-Gefühl erinnert und sie so mit den Palästinensern zur globalen Schicksalsgemeinschaft zusammenschweißt – weil sie wissen, wie sich Diskriminierung anfühlt, solidarisieren sie sich mit betroffenen Palästinensern.
Die Ursache für israelbezogenen »Antisemitismus« liegt also nicht in der Religion. Ohne soziale Gerechtigkeit ist innenpolitischer Frieden nicht denkbar. Das gilt sowohl in Hinblick auf die deutsche Integrationspolitik als auch in Bezug auf den Nahost-Konflikt.
Solange es Palästinensern an Perspektiven und Chancen mangelt, solange sie nicht flächendeckend dieselben Rechte wie Israelis haben, wird der Samen radikaler Gruppen auf fruchtbaren Boden fallen. Es reicht nicht, die aggressive Siedlungspolitik in Israel als völkerrechtswidrig zu verurteilen, wenn sich gleichzeitig für die von der Besatzung Betroffenen nichts verändert. Hass gedeiht, wenn Menschen sich ohnmächtig fühlen und eine Projektionsfläche suchen, um ihre Wut zu kanalisieren.
Ebenso wenig wird man arabischstämmige Migranten mit schriftlichen Bekenntnissen zum Existenzrecht Israel davor bewahren, antisemitisches Gedankengut zu pflegen. Wir leben in Deutschland in einer Rechtsgemeinschaft, keiner Gesinnungsgemeinschaft. Verlangt werden kann ein Gesetzesgehorsam, nicht jedoch ein Werte-Gehorsam. Von Werten muss man überzeugt sein. Doch wie wollen wir andere überzeugen, wenn es uns nicht gelingt, Werte glaubwürdig vorzuleben? Wenn der Eindruck entsteht, manches Leben sei wertvoller als anderes? Wenn unsere »wertegeleitete Außenpolitik« darin besteht, den Rüstungsexport nach Israel zu verzehnfachen, statt einen Waffenstillstand zu fordern?
Verstehen heißt nicht rechtfertigen
Diesen Zusammenhang zu sehen, heißt nicht, Gewalt zu rechtfertigen. Er hilft aber sehr wohl, die wirklichen Ursachen für Missstände in bestimmten Bevölkerungsgruppen zu erkennen. Es gibt zwei Erklärungsansätze für ungleiche Entwicklungen: »Entweder ist es die Rasse oder der Rassismus«, erklärt der Soziologe Aladin El-Mafaalani. Entweder wir machen die Religion des Islam verantwortlich für den Antisemitismus der hier lebenden Muslime und für den Terror der Hamas in Nahost – und betreiben damit Kulturrassismus. Oder wir erkennen, dass Ungerechtigkeit, strukturelle Diskriminierung und Ungleichheit die Wurzeln eines Nährbodens bilden, auf dem Hass gut gedeiht.
»Terrorismus kann eine Erscheinungsform von Verzweiflung sein«, schreibt der KZ-Überlebende UN-Diplomat Stéphane Hessel in seinem berühmten Essay »Empört euch« in Bezug auf den Gaza-Streifen. »In der Verzweiflung ist Gewalt ein bedauerlicher Kurzschluss zur Beendigung einer für die Betroffenen unerträglichen Situation«, heißt es dort. Sie sei »leider verständlich«. Der menschenverachtende Terror, der die Vernichtung des Feindes zum Ziel hat, ist durch nichts zu rechtfertigen. Der Wahn verblendeter Ideologen ist durch nichts zu erklären. Und doch schreibt der renommierte Historiker und Genozid-Forscher Omar Bartov, müsse der verabscheuungswürdige Angriff der Hamas »als Versuch gewertet werden, die Aufmerksamkeit auf die Notlage der Palästinenser zu lenken«.
Das mag wie Hohn klingen angesichts des Leids, den die Terroristen hier über die Israelis, aber vielmehr noch über ihre eigene Bevölkerung bringen. Doch es erklärt, warum Gewalt immer wieder Anhänger findet.
Verstehen heißt nicht rechtfertigen, es gibt immer eine Wahl. Verstehen ist jedoch die Voraussetzung zur Heilung der schrecklichen Krankheit namens Terror. Nur wer die Ursachen für das Entstehen und Gedeihen dieser Krankheit begreift, kann das geeignete Gegenmittel finden.
»Bomben können Territorien gewinnen, aber keine Herzen. Gewalt kann Köpfe beugen, aber nicht den Geist«, sagt der ehemalige Kalif der muslimischen Ahmadiyya Gemeinde, Mirza Tahir Ahmad. Mit Verboten und Kriegen mag symbolpolitisch der Eindruck erweckt werden, man würde den Hass bekämpfen. Langfristig wissen wir, wird der Hass nur wachsen.
»Glaubt irgendjemand, dass die vollständige Zerstörung der Hamas gelingen kann?«, fragt der französische Präsident Emmanuel Macron und fordert eine dauerhafte Waffenruhe. Der ägyptisch-stämmige Arzt und Entertainer Bassem Youssef vergleicht die Hamas mit einem Virus, der das Volk der Palästinenser befallen hat, und fragt: »Was würden Sie als Arzt tun, wenn ein Patient mit einem Virus zu Ihnen kommt?« Die Antwort: Jeder vernünftige Arzt würde Ruhe und Unterstützung verordnen, damit das Immunsystem des Patienten selbst mit dem Virus fertig werden kann.
Wer das Virus des Hasses ausrotten will, muss den Schrei nach Gerechtigkeit und einem menschenwürdigen Leben ernst nehmen. Erst dann wird es dauerhaften Frieden und Sicherheit für alle geben können.





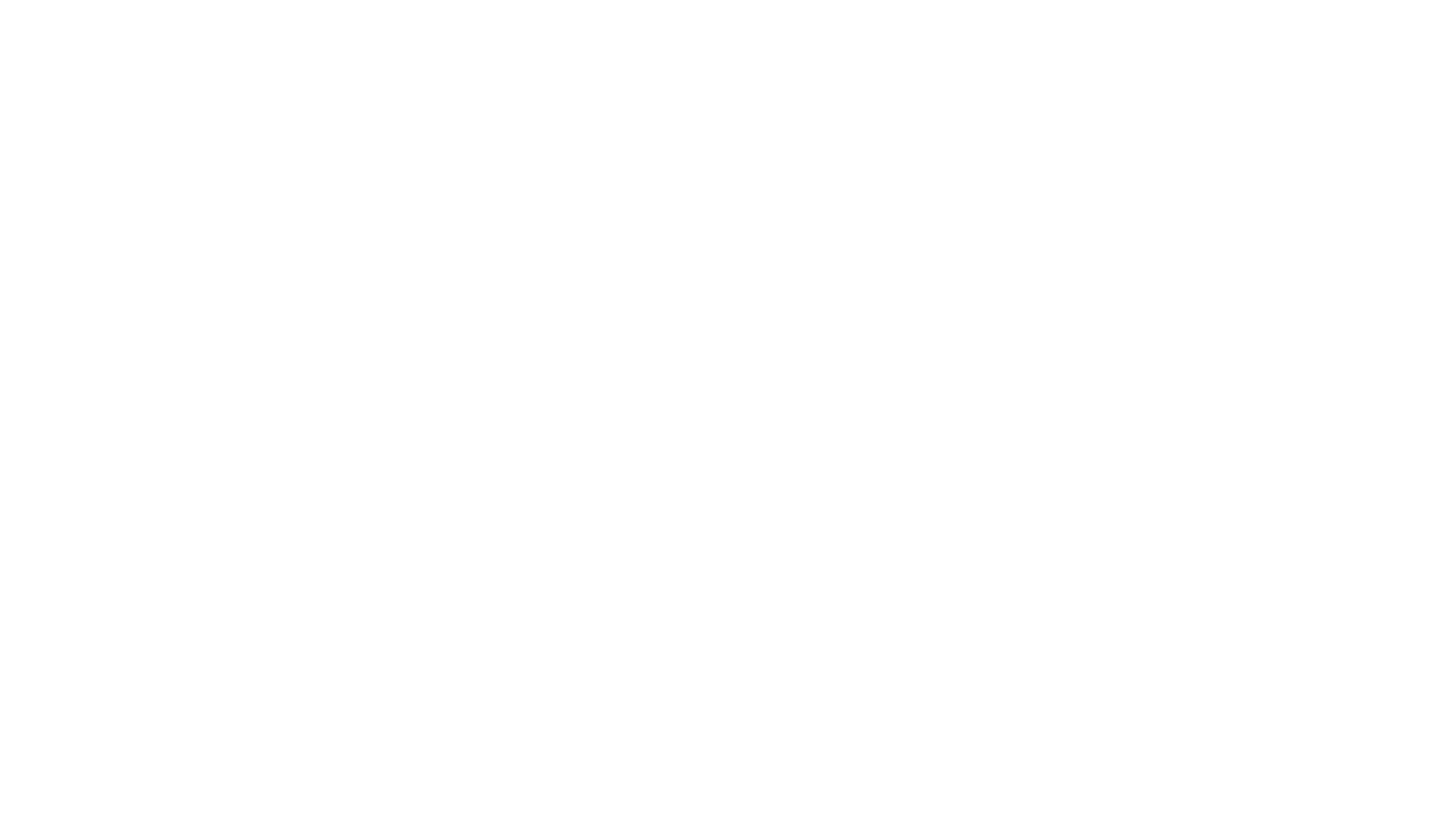
Kommentar hinzufügen