Von Khola Maryam Hübsch

Meine Schwägerin ist die beste Lehrerin, die ich kenne. Geweint hat ihre Klasse, als ihre Zeit als Vertretungslehrerin in einer Problemschule zu Ende ging. Die sonst als schwer erziehbar verrufenen Schüler hatten schweren Herzens Geschenke und Briefe zum Abschied mitgebracht. Denn ihre Lehrerin hatte ihnen nicht nur Deutsch und Mathematik beigebracht, sie hatte an sie geglaubt, sie herausgefordert und ihnen Mut gemacht. Doch trotz Bestnoten hat meine Schwägerin immer noch keine feste Anstellung. So beliebt sie bei den Schülern auch sein mag: Die Lehrer haben Angst vor ihr – denn sie trägt ein Kopftuch. Die regelmäßig aufpoppende Debatte über Kopftuchverbote, sei es für Lehrerinnen oder Schülerinnen, hinterlässt ihre Spuren. Dabei gibt es nicht einen einzigen gemeldeten Fall, in dem das Kopftuch den Schulfrieden gestört hätte. Es gibt keine konkreten Zahlen über die Anzahl von Schülerinnen, die ein Kopftuch in der Grundschule tragen. Und man weiß auch nicht viel über ihre Motive.
Es gibt jedoch eines, das wir seit kurzem mit Gewissheit wissen: Fast 90 Prozent der Schülerinnen sind gegen ein Kopftuchverbot! Diejenigen, die ein Verbot am stärksten treffen würde und die direkt davon beeinflusst wären, lehnen es mit überwältigender Mehrheit ab. Das zeigt eine kürzlich veröffentlichte, repräsentative Studie des DeZIM-Instituts. Wie wenig die öffentlich erregt geführte Debatte mit der tatsächlichen Lebensrealität zu tun hat, zeigen auch folgende Ergebnisse: Menschen, die keinen Kontakt zu Muslimen haben und die Pluralität und Migration ablehnen, befürworten ein Kopftuchverbot eher. Dagegen lehnen 70 Prozent derjenigen, die auch nur ab und zu mit Muslimen zu tun haben, ein Verbot ab – wie auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung.
Wie wichtig das persönliche Gespräch ist, weiß auch meine Schwägerin. Vor ihrem ersten Elternabend wird sie von der Schulleitung vorgewarnt: Es könnte Probleme geben. Doch dieselben Eltern, die im Vorfeld noch krittelten, sind nach dem Elternabend kaum wiederzuerkennen, so sehr sind sie von der Kompetenz und dem Humor der neuen Lehrerin angetan. Warum also diskutieren wir alle paar Monate über dieses Stück Stoff ohne auf die konkreten Fälle und empirischen Zahlen zu schauen? Geht es wirklich um das Kindeswohl?
Immer wenn Zwang im Spiel ist, ist eine Grenze überschritten. Wir verkennen jedoch, dass dies in den seltensten Fällen zutrifft. Unabhängige Beratungsangebote, pädagogische Maßnahmen und gezielte Intervention sind dann zielführender als mit einem gesetzlichen Pauschalverbot eine Kultur des Verdachts zu nähren. Gerade Muslime könnten dabei sinnvolle Kooperationspartner sein. Denn Moscheegemeinden und Imame erklären unisono, dass das Kopftuch für Kinder nicht vorgeschrieben ist. Der Fünfte Kalif der Ahmadiyya Muslim Jamaat, seine Heiligkeit Hadhrat Mirza Masroor AhmadABA betont, dass der Islam das Kopftuch nicht für Kinder vorschreibt: »Erst wenn die physische Reife erlangt ist, was in der Regel in den Teenage-Jahren der Fall ist«, ist es eine religiöse Pflicht. »Also gibt es keine Notwendigkeit für ein Grundschulmädchen, das Kopftuch zu tragen«, erklärt Seine Heiligkeit und führt aus: »Wenn aber ein Mädchen im Grundschulalter das Kopftuch freiwillig tragen möchte, weil es sieht, wie seine Mutter oder ältere Verwandte es tragen, dann ist das ihre persönliche Angelegenheit, es ist nichts Falsches darin. Wenn ein Mädchen natürlicherweise von ihrer Mutter inspiriert wird, ist das etwas Positives. Kleine Kinder, Mädchen und Jungs, ahmen häufig ihre Eltern nach, das gehört zum Erwachsenwerden dazu«1. Wenn Kinder ihre Eltern nachahmen, spricht das für eine gute Beziehung – und nicht unbedingt für Nötigung.
Die Schule ist zudem kein steriler Ort, den man mit Verboten »schont«, sondern die beste Umgebung, um den Umgang mit Konflikten zu lernen und auf eine plurale Gesellschaft vorzubereiten. Ein einseitiges Verbot dagegen problematisiert ein Kleidungsstück, dem ohnehin mit Misstrauen begegnet wird. Dass es für viele jungen Frauen ein Ausdruck ihrer Spiritualität, ihrer Liebe zu Gott und ihrer religiösen Identität ist, wird kaum bedacht. Dabei können religiöse Werte eine kräftespendende Ressource für jungen Menschen sein.
Ohnehin wirkt der Druck seitens der Mehrheitsgesellschaft spätestens ab der Pubertät deutlich stärker: Der soziale Druck, schön, schlank, erfolgreich und sexy zu sein ist popkulturell omnipräsent und steht in keinem Verhältnis zu dem Einfluss, den eine Minderheit kurzzeitig auszuüben vermag. Der Druck, das Kopftuch abzulegen, um seine Karriere nicht zu ruinieren oder schlicht, um der sozialen Ächtung zu entgehen, ist es, der Frauen mindestens ebenso zusetzt wie der Druck seitens Teilen der muslimischen Community. Feministisch zu sein heißt, Frauen zu unterstützen ihren Weg in Freiheit zu gehen und sie nicht mit staatlich oktroyierten Verboten zu schikanieren.
Feminismus heißt auch, sich nicht unbedingt an der Mehrheitsnorm orientieren zu müssen. Eine Mehrheitsnorm, die im Sommer nicht selten so aussieht, dass die Mädchen einer Klasse Hotpants und Spaghettiträger tragen, während die Jungen deutlich bedeckter angezogen sind. Wer das Kopftuchverbot mit einer vermeintlichen Sexualisierung von Mädchenkörpern begründet, gleichzeitig aber kein Verbot von gesellschaftlich weit verbreiteten Phänomenen wie gendergenormter Kleidung und frauenverachtenden Castingshows fordert, macht sich unglaubwürdig. Vor allem wenn die Forderung nicht mit einem Verbot anderer religiös motivierter Kleidung wie Kippa, Turban und Kreuz einhergeht.
Die Neutralität des Staates besteht darin, alle Religionen gleich zu behandeln – nicht darin, Religion von der Schule rauszuhalten. Das betont auch seine Heiligkeit Hadhrat Mirza Masroor AhmadABA: »Alle gläubigen Menschen sollten gleich behandelt werden«, und führt aus: »Kleine Jungen der Sikh-Gemeinschaft tragen häufig einen Turban in der Schule und manchmal tragen jüdische Jungen eine Kippa. Nur die kopftuchtragenden, muslimischen Mädchen herauszugreifen wäre diskriminierend. Alle religiösen Symbole sollten gleichbehandelt werden«.2
Der einseitige Ruf nach einem Kopftuchverbot ist nicht nur diskriminierend, er ist verfassungswidrig und drängt eine bereits marginalisierte Minderheit weiter in die Ecke. Was bei Muslimen ankommt ist: Wir wollen euch nicht und mit Werten wie Gleichbehandlung, Chancengleichheit und Religionsfreiheit meinen wir es nicht so genau. Selbstredend, dass Personaler angesichts eines solch angeheizten Klimas selten ihre Vorurteile überwinden und eine Hijabi einstellen. Gesellschaftspolitisch passiert damit genau das, was verhindert werden soll – die Integration und Emanzipation muslimischer Frauen wird nicht nur erschwert, sie wird regelrecht behindert.
Statt das Kopftuch durch Verbotsforderungen zum roten Tuch zu erklären, brauchen wir mehr Räume, die Muslime und Nicht-Muslime ins Gespräch bringen. Meine Schwägerin würde dann vielleicht erzählen, dass ihr Mann jeden Abend die Küche putzt und auch sonst nicht viel von männlichem Chauvinismus hält. Wer mit denjenigen Köpfen spricht über deren Köpfe hinweg sich gerne um Kopf und Kragen geredet wird, der merkt schnell: Manch ein Kopf mit Tuch ist freier als die selbst ernannten »Frauenbefreier« mit Brett vorm Kopf.
Über die Autorin: Khola Maryam Hübsch ist eine Ahmadi Journalistin und Publizistin. Sie hält Fach- und Publikumsvorträge zum Thema Islam. Sie hat Publizistik, Psychologie und Germanistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz studiert.
Referenzen:
1. Hadhrat Mirza Masroor AhmadABA, März 2018 Ausgabe von »The Review of Religions«
2. Ibid





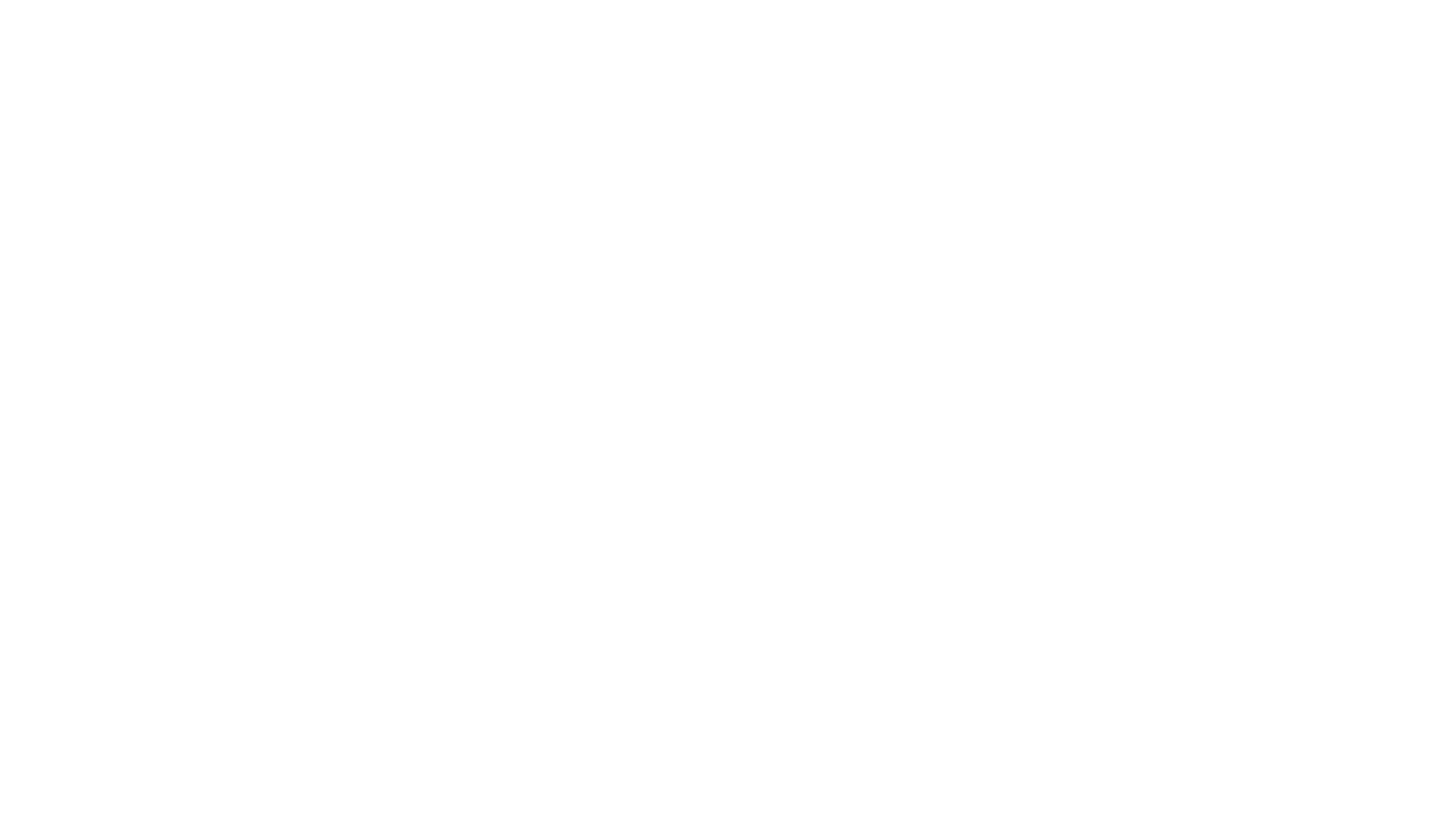
Kommentar hinzufügen